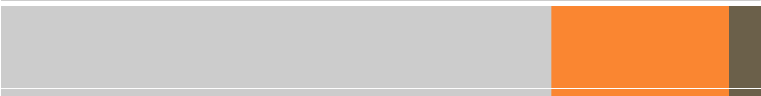Die trans- und interdisziplinären
Zugriffe auf das Computerspiel sind jung, disparat und
noch wenig konsistent, so dass fundamentale Fragen,
wie z.B. ob das Computer-, Konsolen-, Internet- oder
Handyspiel ein Medium, ein Medienimplement oder einfach
nur ein reaktiver Programmcode sei, noch in der Schwebe
sind. Es ist auch gar nicht nötig solch fundamentale
Fragen zu beantworten. Fruchtbringender im Sinne einer
Medienwissenschaft sind die verschiedenen Perspektiven
unter denen das Computerspiel sinnvoll konzeptualisiert
werden kann – sei es die Frage nach der potentiellen
Narrativität, die Frage nach einer Kinematographizität
oder die Frage nach der Einbindung der Rezipienten.
Diese Fragen schaffen zunächst einmal Differenzen
und eine neue Perspektive auf die Konzepte und die beteiligten
Medien.
(Der Text dieser Seite geht
in Teilen zurück auf die gemeinsam mit Britta Neitzel
in Braunschweig gehaltene Einführung zur GfM-Tagung
2004)

Digitale Medien lassen die nicht originär digitalen
nicht unberührt: Im Kino hat der Einsatz der digitalen
Techniken dazu geführt, dass neben der Narration
inzwischen auch das Spektakel mit seiner Stimulation
der Sinne aktuell zu einem wichtigen Teil der kinematographischen
Imagination geworden ist. Digitale Technologien ließen
neue Formen von Kunst und Unterhaltung entstehen, von
interaktiven Videoinstallationen zu Simulationen, in
denen die Umgebungen auf die Bewegungen der Besucher
reagieren. Medientheoretisch lassen sich diese Verschiebungen,
Überschneidungen und Verwebungen unter dem Begriff
der Intermedialität fassen.
zurück
zum Seitenanfang

Das Spiel, zumal das digitale Spiel auf Bildschirmen
(Computer, Konsolen, Handys oder Handhelds), ›nobilitiert‹
sich kulturell zunehmend. Interessant scheint dabei
die Frage, inwieweit dies als ein Aspekt kultureller
und medialer Verschiebungen im Sinne einer subjektiven
wie diskursiven Normalisierung von Medienkultur und
Mediengebrauch zu verstehen wäre oder ob sich hier
beispielsweise nicht auch Aspekte der intermedialen
Verschiebung von Zuschreibungsaspekten beobachten ließen.
Offensichtlich jedoch scheint zu sein, dass das Spiel
sich als Organisationsform einer bestimmten Wissensformation
soweit durchgesetzt hat, dass es als ›rhetorisch
metaphorisierbar‹ angenommen wird.
zurück
zum Seitenanfang

Partizipation ist der Begriff, mit dem der sich wandelnde
Umgang mit den digitalen Medien beschrieben werden kann.
Mit dem Begriff des Spiels kann diese Beschreibung gleichzeitig
konkretisiert, wie z. B. im Computerspiel, als auch
metaphorisiert werden, wie z. B. im Spiel mit Aktien
oder auch dem „zweckfreien“ Herumspielen
mit dem Computer oder anderen Medienformen. Dass der
digitalen Kultur zunehmend häufiger ein ludisches
Potenzial attestiert wird, deutet auf die zunehmende
Bedeutung des Spielbegriffs für die Medienkultur
hin.
zurück
zum Seitenanfang

Während der Begriff Interaktivität vor allem
auf den Umgang mit digitalen Medien abzielt und Aktionen
des Benutzers zu fassen sucht, gehen die Begriffe Immersion
und Interface über den Bereich der digitalen Medien
hinaus. Immersion beschreibt das Hineingezogenwerden
eines Zuschauers, Lesers oder Benutzers in die Welt
des Textes. Die Medien entwickeln hierfür verschiedene
Techniken: eine konsistente narrative Welt, verschiedene
Perspektiven, einen unsichtbaren Schnitt – um
nur einige zu nennen. Es sind Techniken, die die Konstruktion
der Fiktion verstecken.
zurück
zum Seitenanfang

Das Interface stellt, wie der selten gebrauchte deutsche
Begriff der Schnittstelle deutlich macht, die Ebene
dar, an der das Medium als technisches und symbolisches
Artefakt vom Zuschauer oder Benutzer getrennt wird.
Die Modi der Überbrückung dieser Trennung,
d. h. die Schnittstelle als Nahtstelle, sind nun einerseits
Orte der Differenz, zum anderen aber auch Orte der Stiftung
von Transparenzen. Denn Bildschirmspiele neigen dazu
– wie jedes andere Mediensystem auch – die
sie ›tragende‹ Technik zu verunsichtbaren.
Das Interface ist der Ort an dem diese Naturalisierung
von Technik prozessiert wird, zumindest aber signifikant
wird.
zurück
zum Seitenanfang

Die Arbeitsgemeinschaft Computerspiele
der Gesellschaft für Medienwissenschaften (GfM)
ist ein multidisziplinärer Forschungsverbund junger
WissenschaftlerInnen, der seit Anfang 2003 am Feld der
deutschen game studies arbeitet. Die AG Computerspiele
begreift sich somit als Organisator eines transdisziplinären
Metadiskurses: Wie kann man über games überhaupt
distanziert- und angewandt-wissenschaftlich sprechen?
Die AG verpflichtet sich der Förderung der wissenschaftlichen
Erforschung von Computerspielen und – dezidiert
– der Stärkung der interdisziplinären
Zusammenarbeit über Fachdisziplinen und Ländergrenzen
hinaus; hier vor allem mit dem Ziel, geistes- und sozialwissenschaftliche,
informatische, gestalterische, naturwissenschaftliche
usf. Belange historischer ästhetischer, technischer
oder inhaltlicher Konturierung, die sich im weitesten
Sinne um die Beschäftigung mit Computer- oder/und
Konsolenspielen befassen, zu bündeln. Darüber
hinaus versteht sich die AG auch als Plattform der Vermittlung
dieser wissenschaftlichen Erforschung von Computerspielen
– vorrangig innerhalb des deutschsprachigen Raumes,
aber auch in Kontakt mit internationalen Partnern. Ebenso
ist die AG ein Ort der Diskussion zukünftiger und
aktueller akademischer Forschung und Lehre im Bezug
auf Computerspielwissenschaften bzw. game studies. Als
Arbeitsplattform hat sich die online-Präsenz der
AG etabliert (www.ag-games.de)
Als Ansprechpartner fungieren aktuell:
Dr. Britta Neitzel
britta (punkt) neitzel (at) gmx (punkt) de
Prof. Dr. Rolf F. Nohr
r (punkt) nohr (at) hbk-bs (punkt) de
Aktuelle Informationen unter
www.ag-games.de
zurück
zum Seitenanfang
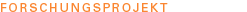
»Strategie spielen: Steuerungstechniken und strategisches
Handeln in populären Computerspielen (am Beispiel
von Wirtschafts-, Militär- und Aufbausimulationen)«
Computerstrategiespiele sind populäre rundenbasierte
und handlungsbezogene Simulationen, die in ein (kriegerisches,
ökonomisches oder gestaltendes) narratives Setting
eingebunden sind. Im codebasierten Computerspiel scheint
zunächst nur das strikt regelgerechte, der Codevorgabe
angepasste Handeln zur Siegbedingung zu führen.
Ziel des Projekts ist die medientheoretische Erforschung
dieser computerbasierten Strategiespiele. In drei Teilprojekten
soll das Dispositiv des Strategischen, das sich in diesen
Spielen medial realisiert, untersucht werden. Die medientechnisch
erzwungene Rationalisierung des Strategischen geht als
mediales Apriori in die innere Form der Spiele ein,
die Strategie stets als kalkulierbare, berechenbare
(und somit auf den Computer zugeschnittene) Handlungsform
implementieren müssen. Darüber hinaus erscheint
es äußert bemerkenswert, dass zahlreiche
Strategiespiele durch die Simulation komplexer dynamischer
Prozesse nach realweltlicher Vorbilder inszeniert und
als steuerbar gekennzeichnet sind.
Ziel des Projekts insgesamt ist es, nicht nur einen
neuen Gegenstand - das Genre des Strategiespiels - für
die Medienwissenschaft zu erschließen, sondern
erwartet wird darüber hinaus ein Beitrag zur Profilierung
einer medien- und kulturwissenschaftlich orientierten
Computerspielforschung, die anschlussfähig ist
an die im angelsächsischen Raum sich zunehmend
etablierenden ›game studies‹
Weiter Informationen zu dem sich aktuell in der ersten
Phase befindlichen Forschungsprojekt finden Sie auf
der Projekthomepage:
www.strategiespielen.de
zurück
zum Seitenanfang

Das Institut für Medienwissenschaft der HBK Braunschweig
war der Veranstalter der Jahrestagung »Das Spiel
mit dem Medium – Immersion, Interaktivität,
Interface« der Gesellschaft für Medienwissenschaft
(GfM). Vom 30. September bis zum 2. Oktober 2004 thematisierten
die Vortragenden schwerpunktmäßig das Computerspiel.
So führt die GfM eine früh begonnene Tradition
fort: Die Auseinandersetzung mit neuen und gesellschaftlich
wie politisch relevanten Medienkonstellationen.
Ziel der Tagung war es sich von unterkomplexen, wirkungsspekulativen
und medienpessimistischen Diskursen abzugrenzen und
vielmehr eine konstruktive und multidisziplinäre
Beleuchtung des »Spiels im Medium« anzubieten.
Zur
Tagungshomepage
zurück
zum Seitenanfang

Die Ergebnisse der Jahrestagung wurden dokumentiert
in:
Rolf F. Nohr/Britta Neitzel (Hg.) (2006): Das Spiel
mit dem Medium. Partizipation – Immersion –
Interaktion. Zur Teilhabe an den Medien von Kunst bis
Computerspiel. Marburg: Schüren [Schriftenreihe
der Gesellschaft für Medienwissenschaft, Bd.14].
Weitere Informationen
Ein erstes Projekt des Forschungsverbundes AG Games
war der interdiziplinäre Band zur SILENT HILL-Serie:
Rolf F. Nohr/Britta Neitzel/Matthias Bopp (2005): ‚See?
I´m real...‘.Multidisziplinäre Zugänge
der Computerspielforschung am Beispiel SILENT HILL.
Münster: LIT [Reihe Medien ´ Welten Bd. 5].
Weitere Informationen
zurück
zum Seitenanfang
(c) 2003 Rolf F. Nohr
|